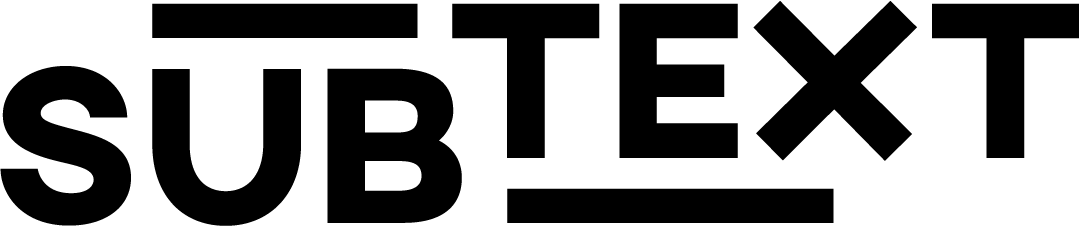Separatfrieden – Tom Stoppart
Ein gesunder Mann checkt in die Privatklinik ein. Damit beginnt Tom Stopparts Drama Separatfrieden aus den Sechzigern, das derzeit im Nestroyhof/Hamakom seine österreichische Erstaufführung feiert. Ingrid Lang bringt das Stück als Regisseurin auf die Bühne und bestätigt damit seine Relevanz.
Blau machen ist doch der Traum jeder Schülerin, Studentin und Person im Berufsalltag. Sich einfach mal ausruhen – das wäre doch schön! Und noch besser als die Krankschreibung von der Ärztin zu holen und daheim tagelang fern zu sehen, ist zusätzlich Lieferservice direkt ans Bett. Diesen Traum hat sich der Protagonist John Brown in Separatfrieden erfüllt und wir dürfen ihm dabei zusehen.
Die Handlung kurz erklärt
In Tom Stoppards Kurzstück „A Separate Peace“ liefert sich ein Mann namens John Brown scheinbar grundlos in ein Krankenhaus ein. Er wirkt vollkommen gesund, klagt über keine Beschwerden, und dennoch möchte er nicht entlassen werden. Das medizinische Personal ist ratlos: Sie finden keinen physischen oder psychischen Befund, der einen Krankenhausaufenthalt rechtfertigt. Sie rätseln und wollen eine Erklärung für die Beweggründe des seltsamen Patienten finden. Ist er ein Psychopath, ein Krimineller auf der Flucht oder gar ein Terrorist?
Trotzdem bleibt Brown ruhig, freundlich und beharrlich – er fühlt sich wohl und sicher im Krankenhaus. Für ihn ist es ein Rückzugsort, ein Ort des Friedens in einer chaotischen Welt draußen. Das führt zu einem absurden Konflikt: Die Ärzte wollen ihn entlassen, er möchte bleiben. Die Situation spitzt sich zu, bis der Verwaltungsapparat eingreift. Am Ende wird John Brown entlassen – und verschwindet spurlos.
Kamouflage der Zeitlosigkeit

Die Inszenierung schenkt vor allem den zeitlosen Themen des Stücks viel Raum. Der Wunsch nach Rückzug und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen wird immer wieder thematisiert. Für die Mitarbeiter:innen der Privatklinik ist John Brown absolut nicht nachvollziehbar. So sieht man sie immer wieder mit ihren Gesichtern an den Milchgläsern kleben um von außen zu spitzeln. Oft auch positioniert sich das Personal geschickt im Raum und verschmilzt mit der Wandfarbe des Zimmers um den Patienten unentdeckt beobachten zu können. Für mich eine sehr gelungene Inszenierung der Absurdität des Stücks.
In einer Zeit, in der mentale Gesundheit und Work-Life-Balance zunehmend diskutiert werden, gewinnt das Stück neue Relevanz. Die Inszenierung könnte daher als Kommentar zur heutigen Leistungsgesellschaft verstanden werden, in der der Wunsch nach Ruhe und Selbstbestimmung oft als Anomalie betrachtet wird.
Dass der Stoff in den 1960ern entstanden ist, merkt man jedoch trotzdem recht schnell. Ich hätte John Brown definitiv eine Depression angehängt und zusätzlich PTSD. Er hätte 2025 genügend Gründe, um in der Privatklinik zu bleiben und behandelt zu werden. Außerdem gehe ich davon aus, dass Privatkliniken heute mit Freude Patient:innen aufnehmen, die ihr Geld in ihren Rachen stecken wollen.
Ein Affe singt mir Gute Nacht

Meine Geduld wird in einigen Szenen stapaziert. So witzig und unterhaltend ich die Szenen am Anfang fand, so meditativ einschläfernd fand ich manch andere auch. Es macht natürlich Sinn John Brown minutenlang einen Korb flechten zu lassen. Die Szene unterstreicht die Gemächlichkeit und den Wunsch nach dem Nichtstun fantastisch. Nichtsdestotrotz tue ich mir schwer hier voll wach zu bleiben und kann das schnarchen meines Nachbarn etwas nachvollziehen. Auch die Traumsequenz macht mir als Anhängerin der schnelllebigen TikTok-Generation zu schaffen. Die ständige Wiederholung der immer gleichen gewalttätigen Szene, die zeitlupenartige Fortbewegung der Schauspieler:innen und die unglaublich langsame wiedergabe des Pink Floyed Songs „Us and Them“ schläfert mich ein. Da hilft es auch nicht, dass die Regisseurin im Affenkostüm den Song selbst wirklich gut singt.
Makelloses Spiel

Das Highlight des Stücks ist die schauspielerische Leistung. Als Zuschauerin werde ich sofort und mit einfachen aber billianten Mitteln ins Stück transportiert. Vor allem die wunderschöne Sprache der Darsteller:innen fällt mir auf. Das Bühnenbild und die Kostüme sind einfach gehalten, aber perfekt gewählt. Die Darsteller:innen werden durch eine Brille zur Oberschwester oder ein Stetoskop zum Arzt. So klappt die schnelle Verwandlung und ich weiß sofort wer vor mir steht und mit dem Patienten interagiert.
Mein Kollege und ich gingen aus dem Stück und hatten genug Stoff zur Diskussion. Sowas wünsche ich mir von einem Stück – und die Inszenierung regt definitiv zum Nachdenken und Diskutieren an. Was representiert der Affe? Ich wünsche mir auch oft Ruhe und Frieden, aber würde ich das Nichtstun in Kauf nehmen? Was ist John Brown passiert und warum weist er sich selbst ein? Warum kann ich, wie das Krankenhauspersonal auch nicht akzeptieren, dass er gesund ist?
Fazit
Die Darsteller:innen, die Bilder auf der Bühne, der Stoff – all das ist ein Grund sich das Stück anzusehen. Ich würde mir lediglich wünschen, dass aus dem einst 30-minuten langen Stück etwas weniger als 80 Minuten geworden wären. Ich verstehe die Langsamkeit der Inszenierung, nach einem langen Tag ist die Trägheit des Nichtstuns jedoch schwer zu ertragen. Und das bestätigt auch mein Blick ins Publikum, in dem ich einige schläfrige Gesichter sehe. Wer wunderschöne Schauspielkunst sehen will und einen Stoff zum Diskutieren braucht, besucht ordentlich ausgeschlafen das Theater Nestroyhof/ Hamakom.
Tickets zu den weiteren Vorstellungen von Separatfrieden im April und Mai 2025 findet ihr auf Hamakom.at
Fotos: Marcel Köhler