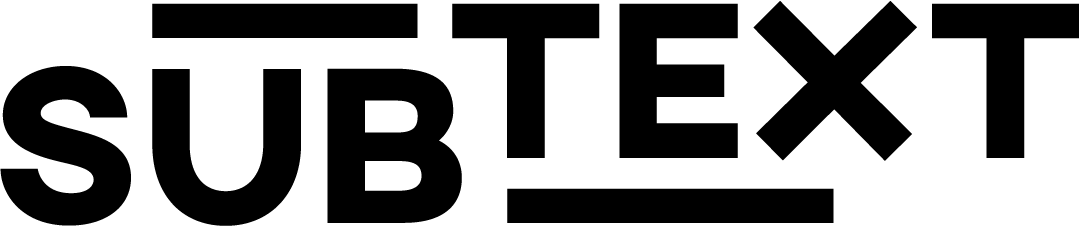LANA DEL REY – Graues Mäuschen
Megabrutal oder doch nur ein Schlag ins Leere? Messerscharf kalkuliert und total berechnend trifft auf „Ultraviolence“, das zweite Album von Lana Del Rey, wohl eher zu. Doch wir müssen ehrlich sein an dieser Stelle: War ihre Version von Pop, geschmückt mit allerlei amerikanischen Zitaten und Referenzen, nicht schon immer gestellt und künstlich? Das Wort „Money“ steckt jedenfalls in gleich zwei Titeln und ist bestimmt, wie alles bei der 28-Jährigen, kein Zufall.
Lana Del Rey entdeckt nach „Born To Die“ und dem Zusatz „The Paradise Edition“ den Superlativ für sich, tut uns damit aber alles andere als einen großen Gefallen. So handzahm hat man die US-Noir-Sängerin eher selten erlebt. Der Opener „Cruel World“ überrascht mit einer Länge von über sechs Minuten und einem sphärischen Klangbild, dass noch zu begeistern weiß. Der Titeltrack erinnert an „Summertime Sadness“, wenn auch der Refrain getragener ausfällt. Überhaupt ist das Material auf „Ultraviolence“ in seiner Gesamtheit sehr gediegen. Da fragt man sich, was Produzent Dan Auerbach (The Black Keys) mit seinen Soul- und Bluesrock-Wurzeln angestellt hat. Nirgends rumpelt es, der Biss fehlt und ein Feuer ist selten zu spüren. Die Leidenschaft, sie lodert nicht. Stattdessen gibt sich Lana der Melancholie im Übermaß hin.
Wenn in „Shades Of Cool“ der Gesang ins Falsett überkippt, ist das wahrlich kein großer Moment. Ein Song wie „Sad Girl“ ist zu sehr auf Image getrimmt und „Pretty When You Cry“ ist zäh wie ein alter Kaugummi – da hätte man lieber auf den gleichnamigen Song von Vast zurückgreifen können. Ein Cover wäre hier Gold wert gewesen. „Old Money“ schlägt in die Kerbe wie der Titeltrack und „The Other Woman“ kommt einem wie ein Abspann eines Stummfilms vor, wenn auch erneut handzahm vorgetragen. Schmissiger ist da schon „Fucked My Way Up To The Top“ ausgefallen. Der Titel wird bestimmt dazu führen, dass Feministinnen erneut auf die Barrikaden gehen. Die Zeile „I’m a dragon, you’re a whore, don’t even know what you’re good for“ zaubert einem ein Schmunzeln ins Gesicht.
Die verträumte Single „West Coast“, die bei der Plattenfirma auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, lässt einen an Fußabdrücke auf Sandstränden denken. Hier gefallen die Strophen mehr als der eigentliche Refrain. „Brooklyn Baby“ ist eine Art Geheimtipp. Ein schleppender Beat, eine kindliche Aura, ein zartes Gitarrenpicking – Lana-Pop at its best.
Die Euphorie scheint mit „Ultraviolence“ trotz allem erst mal dahin. Die Farbe ist abhanden gekommen – wie auf dem Cover, wo uns Lana Del Rey als graues Mäuschen begegnet. Sie verwertet sich und ihre künstliche Politur weiterhin supereffizent und geschickt, doch das Songwriting muss auf Albumlänge einfach zwingender und stärker werden. Anachronistischer Pop und große, fragile Songs voller inständig präsentierter Traurigkeit reichen nicht mehr aus, um einen bei Laune zu halten. Aus diesem Grund hinterlässt das Werk einen eher müden, lethargischen Eindruck. Ob solch ein laues Lüftchen von einem Album dafür sorgt, dass es auch zukünftige Veröffentlichungen der 28-Jährigen nur im Plattenfirmenbüro unter Aufsicht (inklusive Schweigevertrag) zu hören geben wird, sei mal dahingestellt.

lanadelrey.com
facebook.com/lanadelrey
twitter.com/LanaDelRey