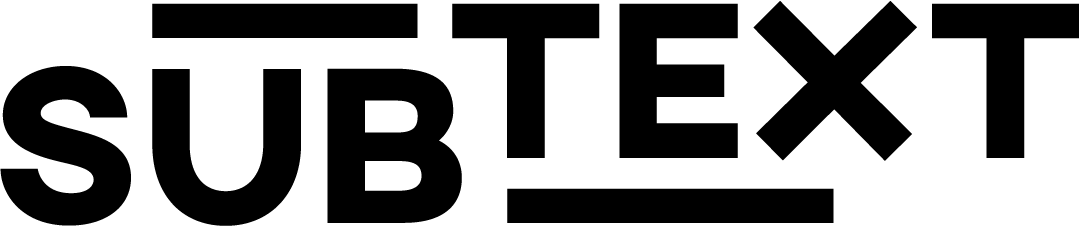Namaste ade: Placebo live in Wien
Weniger als 7000 Fans finden sich am 02. November in der Wiener Stadthalle ein, um die Briten endlich wieder live zu erleben. Es wird hier schon deutlich: Placebo backen inzwischen etwas kleinere Brötchen und haben mit Zuschauerschwund zu kämpfen. Woran liegt’s? Am neuen, fabelhaften Longplayer „Never Let Me Go“ jedenfalls nicht.
Dieser ist mit elf Songs fast komplett vertreten. Placebo kleckern nicht, sie klotzen. Der Sound? Wuchtig und von Anfang an viel zu harsch. Die Visuals? Astrein. Und die Band? Maulfaul und zurückhaltend. Es sind also keine optimalen Bedingungen, um diesen Abend ohne Bedenken genießen zu können.
Bevor Placebo um 21h die Bühne betreten, lassen Dead Letter aus UK mit ihrem rotzig vorgetragenen Post-Punk britischer Schule aufhorchen. Anschließend wird auf den Videowalls der Appell projiziert, sämtliche Smartphones während der Vorstellung doch links liegen zu lassen. Was allein zählt, ist der Moment, der Augenblick, der so in dieser Form nie wieder stattfinden wird. Sehr löblich. In der Halle selbst sorgen Aufkleber dafür, dass man mit dieser Bitte möglichst früh in Berührung kommt. Wer dennoch einen Schnappschuss aufnimmt (recht wenige) wird von pikierten Securitys mit blendender Taschenlampe ermahnt. Weshalb Brian Molko und Stefan Olsdal später ihr Set dennoch so reserviert und kühl vortragen, lässt sich umso schwerer beantworten.
Die Atmosphäre ist grundsätzlich gedrückt und angespannt, wenig euphorisierend. Ohne Handys in der Luft schaffen es Placebo nicht, eine Verbindung zum Publikum während einem Großteil der neuen Songs herzustellen. So bekommt das Konzert einen Dienstleistungscharakter aufgestülpt, der nicht so recht zu den mitreißenden Liedern von „Never Let Me Go“ passen will. „What’s the difference anyway“, sang Molko einst in „Too Many Friends“ – ein Prinzip, was sich an diesem Abend leider bewahrheitet.
Placebo wirken fast den ganzen Abend so, als ob sie sich mit dem Publikum nicht auf ein gemeinsames Temperament verständigen können. Molko schweigt sich bis auf einige Gesten komplett aus und Olsdal gibt sich wenigstens mit ein, zwei Sätzen Mühe, eine Nähe zu den Leuten aufzubauen. Wie ein vor sich hin und her bewegendes Pendel mühen sie sich mit dem neuen Material ab, welches auf Platte mehr überzeugt als auf der Bühne. Mit dem schmissigen „For What It’s Worth“, dem gern gesehenen „Song To Say Goodbye“ oder dem groovenden „Infra-Red“ schummeln sich dann endlich einige Höhepunkte im hinteren Drittel ins Set, welche die Menge in Bewegung versetzen. Auch der Zugabenteil mit dem Tears For Fears-Cover „Shout“, dem elektronisch-elegischen „Fix Yourself“ und dem obligatorischen Kate Bush-Cover „Runnig Up That Hill“ gelingt, weil die Band es hier versteht, den jeweiligen Songs ihre spezielle Tiefe zu verleihen und mit dem Publikum zu teilen.
Krisen gibt es momentan mehr als genug auf der Welt. Placebo begegnen denen mit brachialem Sound, der undifferenziert aus den Boxen kommt. Nicht nur deswegen ist Konfliktpotenzial vorhanden. Die Zeiten, die sind hart und schwierig und das Duo (mitsamt Tourmusikern) antwortet aufreibender und härter als zuletzt. Was die Performance angeht, nehmen Placebo kein Bad in der Menge. Sie wagen nur den kleinen Zeh hinein, anstatt sich nach all den Jahren im Applaus zu verlieren und vollends mit Hingabe zu überzeugen. Auf diese Art und Weise lässt sich die Stimmung nur mit Mühe und Not aus den Angeln heben.
2016 zeigte sich Molko noch musikalisch nuancierter und charakterlich mitteilsam (siehe hier) und heuer ist der 49-Jährige sound-technisch grobklotzig unterwegs und überhaupt nicht gesprächig. Natürlich färbt das auf die Laune von allen ab, die dadurch noch gedrückter und unentspannter wird, was bereits in sozialen Medien heftig diskutiert wird. Molko scheint tief in seiner eigenen Gedankenwelt verstrickt zu sein. Aus dieser Haltung entsteht weder zum Publikum noch zu Bandmitglied Olsdal eine besondere Verbindung, was bei den tollen Songs von einst und jetzt besonders schwer wiegt. In diesem Sinne: Try better next time.