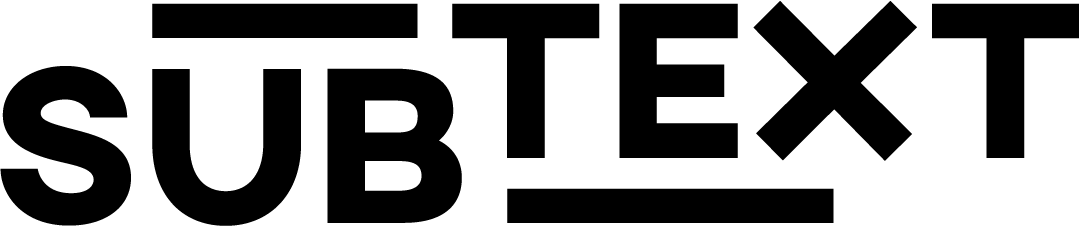Im Spannungsfeld: The Dialogue Police
Was passiert, wenn die Polizei nicht einschreitet, sondern zuhört? In ihrer eindringlichen Dokumentation „The Dialogue Police“ begleitet die schwedische Regisseurin Susanna Edwards eine Spezialeinheit, die im Spannungsfeld von Demonstrationen, politischem Extremismus und gesellschaftlicher Spaltung vermittelt.
Wie lässt sich das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung schützen, ohne dass es in Chaos oder Gewalt umschlägt? Inmitten hitziger Wahlkampfzeiten und wachsender gesellschaftlicher Spannungen wirft die Dokumentarfilmerin Susanna Edwards einen aufrüttelnden Blick auf eine ungewöhnliche Antwort: die „Dialogpolizei“. Ihre Kamera begleitet die Einheit, die dort eingreift, wo Fronten aufeinandertreffen – zwischen Klimaaktivist*innen und Faschisten, zwischen Empörung und Eskalation. The Dialogue Police dokumentiert nicht nur ein Polizeimodell, sondern einen Versuch eine Antwort auf den Schutz der Meinungsfreiheit und Polizeigewalt zu finden.

Geballte Staatsgewalt
Die Dokumentation beginnt mit der Einschulung einer neuen Polizistin bei der Dialogpolizei – ein erzählerischer Faden, der sich durch die erste Hälfte des Films zieht und zugleich die körperlich wie emotional fordernde Arbeit dieser Spezialeinheit thematisiert. Im Verlauf der Laufzeit wird deutlich: Die Tätigkeit der Dialogpolizei ist echte Schwerstarbeit. Und doch stehen ihre Bemühungen im scharfen Kontrast zu Szenen, in denen andere Polizeieinheiten mit unnötiger Härte gegen Demonstrierende vorgehen. Immer wieder drängt sich die Frage auf: Sollten nicht alle Polizist*innen auch Dialogpolizist*innen sein? Wenn Menschen grundlos geschlagen oder gewaltsam abgeführt werden – selbst dort, wo Deeskalation möglich wäre – und es zu Spannungen zwischen der Dialogpolizei und regulären Polizeieinheiten kommt, wird klar: Diese Form der Polizeiarbeit existiert nicht ohne Grund und doch ist sie auch Teil einer geballten Staatsgewalt.
Hass & hetze = Meinungsfreiheit?
Neben den beobachtbaren Einsätzen wirft der Film auch eine tiefgreifende ethische Frage auf: Wie weit reicht das Grundrecht auf Meinungsfreiheit – und wie kann es geschützt werden, ohne zur Rechtfertigung von Hass zu verkommen? Kann man eine Koranausgabe verbrennen, Menschen sexistisch beleidigen und sich dennoch auf das Recht der freien Meinungsäußerung berufen? Wo endet Meinungsfreiheit – und wo beginnen Hass und Hetze? Inmitten einer zunehmend polarisierten Gesellschaft zeigt die Dialogpolizei eine mögliche Antwort: den Versuch, im Gespräch zu bleiben. Doch selbst die Polizist*innen im Film wirken immer wieder unsicher, ob ihr Einsatz tatsächlich Wirkung zeigt. Subtil begleitet den Film das Gefühl, dass sie sich und anderen ständig beweisen müssen, dass ihre Arbeit „etwas bringt“. Doch wie lässt sich der Erfolg einer Dialogpolizei messen? Wie zeigt man, welche Eskalationen nicht passiert sind? Antworten darauf bleibt die Dokumentation schuldig – doch sie stellt Fragen, über die es sich lohnt, intensiv nachzudenken.
Fazit
The Dialogue Police ist eine Dokumentation, in der sich die Filmschaffenden bewusst im Hintergrund halten und um Allparteilichkeit bemühen. Ihr Ziel ist es nicht, klare Antworten auf die brennenden Fragen rund um Meinungsfreiheit zu liefern, sondern Fragen aufzuwerfen. Dies gelingt dem Film perfekt, auch wenn sich die geradlinige Erzählweise stellenweise wiederholt. Am Ende bleibt The Dialogue Police nicht nur eine sehenswerte Dokumentation über eine ungewöhnliche Polizeieinheit, sondern auch ein stiller Appell an uns alle: In Zeiten wachsender Spaltung und lauter Extreme ist der Dialog kein Zeichen von Schwäche, sondern eine demokratische Notwendigkeit. Wer hinschaut, zuhört und fragt, trägt dazu bei, dass Meinungsfreiheit mehr ist als ein Schlagwort, sondern ein gelebtes Prinzip.

The Dialogue Police
Regie: Susanne Edwards
Schweden / Norwegen / Dänemark 2025
color, 90 Minuten
Schwedisch / Türkisch / Farsi / Englisch OmeU

filmfestival linz
29 april – 04 mai 2025
www.crossingeurope.at
Alle Artikel unter subtext.at/crossing-europe