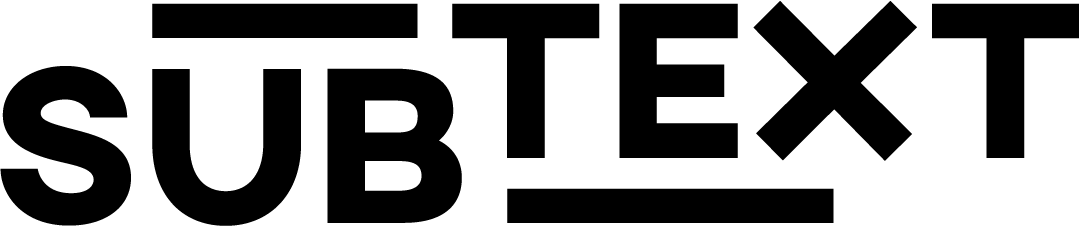„Wir brauchen den Reichtum an Gefühlen“: Maria Radutu über Erkenntnisse aus der Vogelperspektive
Wie der sprichwörtlich mythische Vogel entsteigt die gefeierte Pianistin Maria Radutu mit ihrem aktuellen Album aus der Corona-Asche. Die 36-Jährige hat sich den Themenzyklus der Wiederauferstehung ausgesucht. So weit, so gut. Es sind klassische Stücke von Komponisten wie Strawinsky oder Liszt auf „Phoenix“ zu finden, die im Zusammenhang mit den visuellen Werken von Künstlerin Felicia Gulda, für frischen Wind sorgen. Dieser ist in der heutigen Zeit auch bitter nötig.
Ein Gespräch mit Maria Radutu über Schwüre, Entmystifizierungen und neue Blickwinkel aus alten Erlebnissen.

subtext.at: Maria, betrachtest du die Welt gerne aus der Vogelperspektive?
Maria Radutu: Es war nicht mein erster Gedanke zu dem Album. (überlegt kurz) Ich wollte es nicht von außen betrachten, sondern auf jeden Fall von ganz tief drinnen (lacht). Der Phoenix ist für mich in dem Zusammenhang mehr ein Symbol für diese Wandlung als ein Vogel per se, wobei es mich sehr gefreut hat beim letzten Stück, „Soverreign“ von Mikael Karlsson, dass man schon das Gefühl hat, mit einer gewissen Balance und Kraft drüberzufliegen. Vielleicht habe ich da viel hineininterpretiert, aber so fühlt sich für mich das Stück an (lächelt).
subtext.at: Brauchen wir den Abstand oder eine gewisse Distanz zu den Dingen, um das Wesentliche erfassen zu können?
Maria Radutu: Auf jeden Fall. Ich habe auch „Insomnia“ gemacht vor ein paar Jahren und im Endeffekt dabei diese Nachtstimmungen bearbeitet, die ich selber zwischen 15 und 20 gelebt habe. Das Album habe ich mit 30 gemacht. Man braucht ein paar Jahre, bis man darüber nachdenken kann und es einem auch bewusst wird, was man da eigentlich erlebt hat und wohin es führt.
subtext.at: Was ist das Wesentliche deines neuen Albums „Phoenix“?
Maria Radutu: Es ist der Reichtum, dass wir das alles erleben können. Wenn man das alles erlebt hat, und die meisten haben das, finde ich es faszinierend, wenn man sich zurückerinnert an erlebten Gefühlen, dass man sie Dank der Musik kontrolliert und noch einmal erleben kann. Ich bin ein unglaublich positiver Mensch, aber ich höre wahnsinnig gern fast schon depressive und in sich gekehrte Musik, weil man hineinschwelgen kann, in dieses Gefühl. Sobald die Musik aus ist, ist man auch wieder da. Wir brauchen den Reichtum an Gefühlen, aber es wäre wahrscheinlich zu viel, alles ständig zu erleben (lacht). Wenn man die Musik als Zugang nimmt, um da wieder hineinzutauchen, ist es für mich eine der schönsten Sachen überhaupt, die mir Musik persönlich geben kann.
subtext.at: Als Zuschauer merkt man, wie du auf der Bühne mit den Stücken mitfieberst und wie sich deine Gestik und Mimik dabei verändert.
Maria Radutu: Ja, das kommt davon, weil man sich lange mit den Werken beschäftigt und ich hab das Glück seit einigen Jahren, dass ich nur Programme spiele, die mir selber viel Spaß machen. Ich bekomm’s nicht mit, was ich da genau mache an Gesten, aber es ist schön, wenn das authentisch rüberkommt (lacht).
subtext.at: Konntest du während der Produktion des Albums dein Leben aus einem anderen Blickwinkel betrachten?
Maria Radutu: Für mich und für meine persönliche Geschichte wurde es ein bisschen konkreter, als es sich wie eine eigene Therapieform angefühlt hat. Diese Souveränität, die am Ende dann herauskommt, mit der man dann zurückblickt, die fühlt sich gut an. Es fühlt sich auch gut an, wieder in diese jugendlichen Gefühle einzutauchen. Es ist schön, wenn es so extrem ist und es explodieren kann, aber eine Grundbasis des Sich-erfühlt-Fühlens und eine gewisse innere Balance zu haben, ist schon wichtig. Das kommt erst nach einer Verwandlung und mit einem gewissen Alter. Apropos festgefahrene Einstellungen: Ich hab mir vor zehn Jahren geschworen, ich werd nicht spielen und reden beim Konzert, weil dieser Wechsel eigentlich sehr schwer ist und im Endeffekt hat es sich genau dazu entwickelt. Ich geh darin sehr auf (lächelt).

subtext.at: Legst du dir ein Konzept zurecht oder suchst du zuerst die Songs aus, die du verwenden möchtest?
Maria Radutu: Im Endeffekt stimmt beides. Diese Frage habe ich auch immer unterschiedlich beantwortet. Erst heute musste ich wieder darüber nachdenken. Ganz kurz nach „Insomnia“ waren schon die ersten Gedanken zu „Phoenix“. Bei „Insomnia“ ging es um all die Erlebnisse, die in der Nacht vorkommen können, es gibt auch ein Happy End mit einer Jazzballade von Christoph Cech, und trotzdem ist natürlich ein sehr introvertiertes Album. Bei „Phoenix“ war das allererste Gefühl, dass es wieder raus muss, das Extrovertierte. Für „Insomnia“ musste es lange Zeit zurückgehalten werden. Das war zuerst. Dann hat sich das Thema Feuer entwickelt. Dann das Thema Verwandlung. Es gibt schon Werke, da wusste ich, die müssen aufs Album, aber nicht genau in welchen Kontext. Da kann man sagen: Zuerst das Werk und dann das Konzept. Es gibt aber auch Stellen, da hatte ich keine Werke, wo mir aber ganz klar war, was dramaturgisch passieren muss. Da habe ich nach Musik gesucht oder in Auftrag gegeben. Es gibt zwei Auftragswerke auf dem Album.
subtext.at: Der Phoenix, ein Symbol für Wandlung und Wiedergeburt, steht auch dafür, etwas Neues aus Altem zu vollbringen. Die Neugeburts- bzw. Wandlungssymbolik, die das Album an den Tag legt, passt unfreiwillig in das aktuelle Weltgeschehen.
Maria Radutu: Sehr unfreiwillig (lacht)! Es war nicht der Plan. (überlegt) Ich tue mir schwer mit Menschen, die jetzt im Lockdown sagen, dass man so viele Dinge tun kann. Für mich ist es bedenklich, wie viel von der räumlichen Distanz in uns bleiben wird, weil wir sie jetzt erleben müssen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, damit es mit uns tatsächlich nichts verändert. Dass wir weniger empathisch werden. Jetzt hat man das Gefühl, man möchte nicht, dass sich jemand in der U-Bahn neben einen setzt. Das sind Kleinigkeiten, die vielleicht in dem Moment egal wirken, aber ich habe Angst, dass es nachhaltig etwas verändert. Wir sind soziale Wesen. Schauen wir mal. Bei Kindern, wenn sie das Gefühl haben, die anderen sind gefährlich, fürchte ich die Langzeitfolgen. Für die Musiker ist es eine absolute Katastrophe, wobei wir in Europa noch einigermaßen gut dran sind im Vergleich mit Amerika. Ich kenne Kollegen, die wissen nicht, wie es weitergeht. Ein Drittel des Metropolitan Orchesters sind aufs Land gezogen, teilweise zu den Eltern, weil sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. (überlegt) Die Bühne, diese Kommunikation zum Publikum, auch die Stille, ist eine Komponente, die es besonders macht.
subtext.at: Die Stille, die du ansprichst, ist manchmal schwierig auszuhalten.
Maria Radutu: Ja, stimmt. Das ist eben auch ein Punkt, warum Live-Konzerte so wichtig sind. Musik hat eine Zeitkomponente. Wenn du nicht zuhörst, ist es weg. Zu Hause hat der Künstler kaum eine Chance, den Zuhörer abzuholen mit einem Video. Man kann sofort abdrehen und sich, ich weiß nicht, Popcorn holen. Was auch immer. Dieses Band, was bei Konzerten so besonders ist, wird damit unterbrochen. War es schlimm auszuhalten?
subtext.at: Nein, überhaupt nicht. Es ist einem nicht nur immer bewusst.
Maria Radutu: Es ist vielleicht wie bei den Kindern, die sich nie langweilen dürfen. Oder können, weil sie dauerbeschallt werden. Das sind Momente, wo die Kreativität wieder anfängt, wenn mal Pause ist.
„Wir brauchen einen Neuanfang und neue Perspektiven.“
subtext.at: Das Album will mit Stücken von Chopin, Bartok, Strawinsky oder Liszt alle möglichen Gefühlswelten für die Zuhörer empfindsam machen, was ein ziemlich schwieriges Unterfangen darstellt.
Maria Radutu: (lacht).
subtext.at: Ist das nicht ein sehr hohes Ziel?
Maria Radutu: Es ist schon hoch gegriffen, aber sonst wäre es für mich nicht spannend, da fange ich es erst gar nicht an. Der Moment, wenn das Masterband kommt, ist für mich auch der erste Moment, an dem ich wirklich merke, ob das ganze funktioniert oder nicht. Testen kann ich’s nicht. Das muss mal alles aufgenommen werden, dann kommt dieses Band und dann stellt man fest, ob diese Gefühle wirklich aufgehen, ob die Kontraste wirklich wichtig sind, ob ich mir etwas anders eingebildet habe als es tatsächlich ist als Zuhörer. Das ist immer ganz besonders. Ich dachte zum Beispiel, dass unbedingt nach dem Lied von Liszt nahtlos der Gluck kommen, eben die Akzeptanz, dass alles verbrannt ist, hab aber beim Zuhören gemerkt, dass man tatsächlich ein paar Minuten Luft holen muss. Vor allem in der Livesituation, wo man eben nicht weggehen kann. Das hätte ich davor nicht gewusst. Zwischen Aufnahme und Livekonzert bleibt eine Unbekannte, die sich aufs Band wickelt.

subtext.at: Die abstrakten, impressionistischen Gemälde von Felicia Gulda flankieren die Veröffentlichung von „Phoenix“. Wie kam es dazu?
Maria Radutu: Ich hab immer wieder in letzten Jahren mit anderen Kunstformen zusammengearbeitet, basierend auf einer Grundidee. Für mich ist es inspirierend, weil man etwas in unterschiedlichen Sprachen mitteilen kann. Manche haben mehr Zugang zum bewegten Körper, zum Tanz, manche mehr zur Musik und manche mehr zum Visuellen. Wenn man eine Geschichte erzählen will und man hat unterschiedliche Sprache zur Verfügung, dann erreicht man mehr Menschen. Felicia kannte ich schon und ich wusste, dass sie diese unterschiedlichen Techniken hat. Es musste sie sein. Die Stücke wurden von elf unterschiedlichen Komponisten geschrieben und wenn es ein schaffender Künstler schafft, elf Künstler unterschiedlich darzustellen, dann ist es Felicia.
subtext.at: Einerseits bleiben ihre Werke frei für Interpretationen, andererseits erläuterst du auf der Bühne ziemlich deutlich, welchen Hintergrund die musikalischen Kompositionen haben. Warum?
Maria Radutu: Auf dem Album funktioniert die Musik auch ohne Geschichten, die auch im Booklet stehen. Für mich ist es schon wichtig, dass die Musik funktioniert. Musik braucht keine Bedienungsanleitung. Trotzdem habe ich mich so lange mit der Rolle der Musik beschäftigt, dass ich es dem Publikum in einer Livesituation nicht verschweigen möchte. In dem Moment, wo ich auf de Bühne etwas sagen, gibt es auch Zuhörer, die sich etwas komplett anderes darunter vorstellen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. In dem ich etwas sage, stelle ich auch aber eine neue Verbindung zum Publikum her. Man kann sich daran halten, was ich sage, man muss es aber nicht. Ich sag’s, das ist mir lieber, und was sie dann damit machen, ist ihnen selbst überlassen.
subtext.at: Wodurch wird eine gute Komposition zu einer großartigen?
Maria Radutu: Man kann es schon sagen, es gibt auch sicher Graubereiche und unterschiedliche Meinungen dazu. (überlegt) Eine gute bis sehr gute Komposition zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht immer weiß, was dann kommt. Ich finde es nicht spannend, wenn ich es vorher weiß. Das finde ich schwach. Ob es mir dann dennoch gefällt, ist Geschmackssache. Es gibt sehr gute Kompositionen, mit denen ich emotional wenig anfangen kann. Ich muss aber dennoch anerkennen, es ist gut geschrieben. Es ist halt nicht meins (lacht).
subtext.at: „Wer bin ich und was macht mich glücklich?“, ist eine Frage, die wir uns in unseren hektischen, digitalisierten Welt, öfter stellen. Wir werden mit Eindrücken überrollt, die Regale sind stets voll von Ratgebern und in Frauenzeitschriften gehört der Neuanfang zum Standardrepertoire. Gibt es nicht regelrecht einen Zwang, ständig neu anzufangen?
Maria Radutu: Für mich entwickelt sich das Neue aus dem, was wir erlebt haben. Ich finde es auch nicht gut, wenn es zwanghaft ist. Die Verwandlung wird einem erst später bewusst, um wieder zur Vogelperspektive zu kommen. Wenn man sich neu verwirklichen will, wenn der Wunsch da ist, dann findet man das Alte schlecht und das tue ich ja nicht. Ich sag mit dem Album nicht, alles vorm „Mephisto-Walzer“ ist alt oder schlecht, vor diesem Ausbruch. Es ist auch absichtlich nicht chronologisch, das Neue ist gut. Vor dem „Mephisto-Walzer“ ist es eine Manie in jedem Stück und man ist gefangen in dem Gefühl und das danach hat mehr eine Balance. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass man immer ausbalanciert herauskommt, aus dieser Reise in die Jugend. Es ist schön, wenn man das immer wieder entfachen kann, das Feuer, aber es ist keine Bewertung.
subtext.at: Gibt es eine Einstellung, die du inzwischen über Bord geworfen hast?
Maria Radutu: Viele. Wie ich aufgewachsen bin und auch in der Studienzeit, war ich davon überzeugt, dass man auf jeden Fall auswendig spielen muss. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es stimmt überhaupt nicht. Ich bin viel freier, wenn ich ein iPad hab. Festgefahrene Einstellungen sind gefährlich. Man verliert die Viskosität und auch die Öffnung, Neues zu sehen.
subtext.at: Millionen Menschen träumen vom Neuanfang. Jenseits der 30 fällt es schwer, sich noch zu verändern, sagt die Wissenschaft. Die Soziologen fügen noch hinzu, dass wir fast alles, was wir heute kaufen können, sich in immer kürzeren Abständen erneuert und auch unsere sozialen Beziehungen werden ökonomisiert.
Maria Radutu: Es ist ein Fluch und ein Segen, aber ich finde es gut, dass wir all diese Möglichkeiten haben. Wir haben bis vor 50 Jahren weniger die Partner gewechselt, weil es einfach die Möglichkeiten nicht gab. Das finde ich schlecht. Jetzt zu sagen, ich wechsle den Partner beim ersten Problem, ist auch schlecht. Die Bereitschaft zu kommunizieren, ist hierbei wichtig. Ich veränder mich, weil ich eigentlich unglücklich bin, und erwarte dann, dass ich dann glücklich bin. Das ist der falsche Weg. Man muss in sich hineinhören, was man wirklich braucht. Dann lohnt sich das auch. Die Veränderung macht dich vielleicht nicht glücklich, aber die Kraft schon, die du anwendest, um aus der Situation herauszukommen.
subtext.at: Klassische Musik wird bei uns oft wie ein historisches Ausstellungsstück behandelt. Man stellt sie ins Museum und bringt den Leuten Ehrfurcht bei.
Maria Radutu: Die Distanz erzeugen wir jetzt. Zur Zeit von Beethoven beispielsweise war das überhaupt nicht der Fall. Zur Zeit von Verdi hat das Publikum viel stärker reagiert. Auf Premieren wurden teilweise Tomaten geworfen oder es wurde frenetisch applaudiert. Die Reaktion war viel stärker da, als es jetzt ist. Ich finde es falsch zu sagen, keine Ahnung, man darf nicht lachen bei einem Musikstück. Es gibt genug Komponisten, die Humor einbauen.
Ich stör mich daran, an dieser Wand zwischen Publikum und dem Künstler auf der Bühne. Für Pianisten ist es noch schwerer, weil sie nie ins Publikum schauen. Sie kriegen nur emotional was mit und gar nicht sichtbar. Schubert hat unterhalten zu seiner Zeit. Es hat aber nicht geheißen, dass die Musik weniger wertvoll ist. (überlegt) Es ist wichtig, als Künstler auf der Bühne dem Publikum die Hand zu reichen. Es gibt auch bestimmte Rahmenbedingungen, die einfach die Musik stören. Natürlich würd es nicht gehen, wenn jemand daneben isst (lacht). Diese Entmystifizierung ist dennoch wichtig und die beginnt auch. Es gibt immer mehr Künstler, die spannende Formate haben, die mit dem Publikum kommunizieren und sich genau überlegen, was sie tun. Nicht immer nur Chopin und den Schubert (lächelt).
▼ ▼ ▼
mariaradutu.com
facebook.com/MariaRadutuPiano
instagram.com/mariaradutu
Titelfoto: © Staudinger+Franke