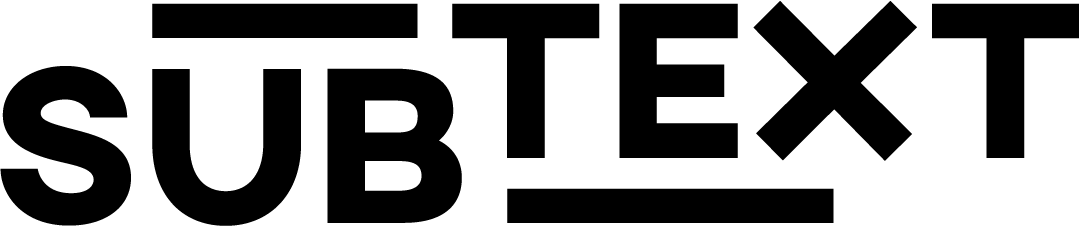An der Front Mutter sein
In My Dear Théo berichtet Alisa Kovalenko über das Leben an der Front nach dem Einmarsch der russischen Truppen im Februar 2022. In videotagebuchartiger Form gelingt ihr ein Porträt über eine für uns surreale Realität. Zwischen Angst, Alltäglichkeit und Mutterdasein.
Wenn man als Westeuropäer Alisas Kovalenkos Dokumentation mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es wohl dieses: unvorstellbar. Zwischen Gräben, Wache halten und dem hin und zurück nimmt sie uns mit auf eine Reise, die grausam ist. Immer wieder versucht sie mit ihrem kleinen Sohn Kontakt zu halten mithilfe von Sprachnachrichten, Videos und Videotelefonaten. „My Dear Theo“ ist ein Film, der seine ganze Wucht erst am Ende entwickelt und doch durchwegs sehenswert ist.
Zwischen den Schützengräben

My Dear Théo ist ein Film zwischen den Schützengräben. Und gerade deswegen ist er meist sehr ruhig und still. Das mag zunächst verwundern, denn man stellt sich das Leben im Schützengraben laut, wuchtig und actionreich vor. Doch das, was dort tatsächlich am häufigsten passiert, ist: Warten. Deshalb ist es nur logisch, dass in den wirklich intensiven Momenten an der Front nicht gefilmt werden konnte – es ist eben immer noch realer Krieg.
Im Verlauf des Films wird deutlich, dass die Regisseurin Alisa Kovalenko immer vertrauter mit der Kamera umgeht und dadurch zunehmend mehr Momente festhält. Interessant ist auch, dass der Film ursprünglich gar nicht als Film geplant war, sondern vielmehr als digitale Erinnerung – als ein Versuch, ihrem Sohn später einmal den Krieg zu erklären.
„Ich habe diesen Film aus Liebe gemacht“
Im Q&A sagt die Regisseurin Alisa Kovalenko: „Ich habe diesen Film aus Liebe gemacht.“ Und das spürt man in jeder Szene. Es ist ein zutiefst persönlicher, fast intimer Versuch, das Unvorstellbare für die Nachwelt zu dokumentieren, ein Hilfeschrei der Erinnerung an die Verbrechen an der Front, aber auch ein Ausdruck des Festhaltens am Menschlichen inmitten der Unmenschlichkeit. My Dear Theo ist kein klassischer Kriegsfilm – er ist Tagebuch, Zeugnis, Mahnmal. Die Kamera wird zu einem verlängerten Blick der Regisseurin, der sich nicht auf Sensation oder Dramatik richtet, sondern auf das Alltägliche im Ausnahmezustand: das Schweigen nach der Explosion, die Müdigkeit zwischen den Schichten, das Warten auf eine Nachricht, auf ein Zeichen von Zuhause. Gerade in diesen leisen Momenten entfaltet der Film seine tiefste Wirkung – ohne Pathos, ohne politisches Statement, aber mit einer stillen Kraft, die lange nachhallt.
Die emotionale Klammer bildet die Beziehung zu ihrem Sohn. Durch Sprachnachrichten, Videos und kleine digitale Fragmente bleibt sie mit ihm verbunden, selbst wenn der Krieg alles andere zu zerstören droht. Der Film ist in diesem Sinne auch ein Akt des Widerstands: gegen das Vergessen, gegen die Entmenschlichung, gegen die Ohnmacht und gegen die Normalisierung eines Krieges.
Fazit
In einer Zeit, in der Bilderfluten und Nachrichtenzyklen oft nur einen flüchtigen Eindruck hinterlassen, ist My Dear Theo ein stiller, entschleunigter Gegenpol. Ein Film, der sich weigert, Krieg spektakulär abzufilmen, und ihn stattdessen fühlbar macht. Er erzählt von Liebe in Zeiten der Zerstörung, vom Wunsch, Spuren zu hinterlassen, und davon, dass selbst im Schützengraben noch Platz für Hoffnung ist.

My Dear Théo
Regie: Alisa Kovalenko
Polen / Tschechien / Ukraine 2025
color, 90 Minuten, Ukrainisch / Polnisch OmeU

filmfestival linz
29 april – 04 mai 2025
www.crossingeurope.at
Alle Artikel unter subtext.at/crossing-europe